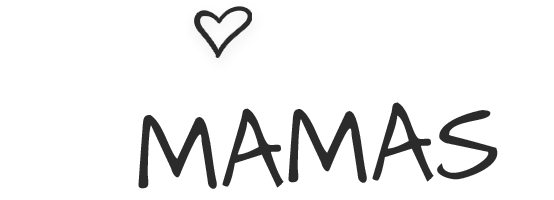Pflegeurlaub und Pflegefreistellung in Österreich
Plötzliche, akut auftretende Erkrankungen von Kindern oder nahen Angehörigen stellen besonders Alleinerziehende oftmals vor große Herausforderungen. Neben der Sorge um den Pflegebedürftigen sowie der Organisation von medizinischen Leistungen bangen viele Betroffene in dieser Zeit auch um den Arbeitsplatz.
Diese Angst ist jedoch unbegründet, da der österreichische Gesetzgeber spezielle Regelungen anbietet, um solche Ausnahmesituationen zu entschärfen. So hat jeder Arbeitnehmer das Recht auf Pflegefreistellung und Pflegeurlaub. Zudem gibt es einige Sonderregelungen, sodass auch ein längerer Pflegebedarf Betroffene nicht sofort in finanzielle Bedrängnis bringt.
- Doch was ist eine Pflegefreistellung überhaupt?
- Wann darf diese beansprucht werden?
- Welche weiteren Möglichkeiten gibt es, wenn selbst der Pflegeurlaub aufgebraucht ist?
Was ist eine Pflegefreistellung?
Alle Arbeitnehmer, die über ein sogenanntes privatrechtliches Arbeitsverhältnis verfügen, dürfen in Österreich eine Pflegefreistellung in Anspruch nehmen. Im rechtlichen Sinne handelt es sich hierbei nicht um Urlaub, sondern um einen zeitlich begrenzten Sonderfall der Dienstverhinderung.
Der Zweck der Pflegefreistellung muss die Pflege von Kindern oder nahen Angehörigen sein, wobei der Arbeitnehmer die Zeit flexibel nutzen kann. So muss die verfügbare Pflegefreistellung nicht in einem Block konsumiert werden, sondern darf auch in einzelne Tage oder Stunden aufgeteilt werden. Während der Dienstverhinderung hat der Arbeitnehmer zudem vollen Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts.
Bei der Entgeltfortzahlung darf der Arbeitnehmer keine finanzielle Schlechterstellung erleiden. Besteht das Gehalt beispielsweise aus einem Grundgehalt sowie Prämien, Diäten oder Kilometergeldern, so kann der Durchschnittsverdienst aus den letzten 13 Wochen berechnet werden, in denen der Arbeitnehmer voll gearbeitet hat.
Wann darf eine Pflegefreistellung in Anspruch genommen werden?
Eine Pflegefreistellung darf immer dann in Anspruch genommen werden, wenn Kinder oder nahe Angehörige, die im gleichen Haushalt leben, erkranken und Pflege benötigen. Lebt die pflegebedürftige Person zwar am gleichen Wohnort, wird jedoch kein gemeinsamer Haushalt geführt, kann keine Pflegefreistellung geltend gemacht werden.
Die Pflegefreistellung ist unabhängig von der Art der Erkrankung. So gelten sowohl akute als auch chronische Erkrankungen als Freistellungsgrund.
Zu den nahen Angehörigen zählen in erster Linie
- Kinder
- Pflegekinder
- Wahlkinder
- Enkelkinder
- Urenkel
- Eltern
- Großeltern.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Pflegefreistellung auch für Ehepartner und Lebenspartner sowie deren Kinder in Anspruch zu nehmen, sofern sie im gleichen Haushalt leben. Homosexuelle Paare sind heterosexuellen Paaren hierbei gesetzlich gleichgestellt. Zudem dürfen leibliche Eltern, die mit ihren Kindern nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, ebenfalls Pflegeurlaub konsumieren. Grundvoraussetzung ist jedoch immer, dass keine weitere Person zur Verfügung steht, der die Pflege des erkrankten Angehörigen zumutbar ist.
Wie lange darf eine Pflegefreistellung maximal dauern?
Jeder Arbeitnehmer hat prinzipiell das Anrecht auf eine Woche Pflegeurlaub pro Jahr.
Diese Woche wird nicht vom regulären Jahresurlaub abgezogen und ist unabhängig von der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen. Bei Teilzeitbeschäftigten wird die Pflegefreistellung aliquot berechnet. Ist eine Person beispielsweise lediglich für 20 Stunden die Woche beschäftigt, so beträgt der jährliche Anspruch auf Pflegefreistellung ebenfalls nur 20 Stunden. Benötigt der Arbeitnehmer eine Freistellung, so hat er die Pflicht, den Arbeitgeber unmittelbar davon in Kenntnis zu setzen.
Die Meldung kann sowohl schriftlich als auch mündlich erfolgen, wobei der Arbeitgeber auch ein ärztliches Attest verlangen kann. Die etwaigen Kosten, die für die Erstellung des Attests entstehen, müssen in diesem Fall jedoch vom Arbeitgeber getragen werden.
Um mögliche Probleme zu vermeiden, raten Experten dazu, Nachweise welche die Pflegebedürftigkeit bestätigen immer schriftlich zu erbringen und aufzubewahren, zumal bewusste Falschangaben zu einer fristlosen Kündigung führen können.
Welche Ausnahmeregelungen gibt es?
Wurde der jährliche Pflegeurlaub verbraucht, so besteht die Möglichkeit einer zusätzlichen Pflegefreistellungswoche. Diese darf konsumiert werden, sofern es sich um die Pflege von Kindern handelt, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
Wurde auch diese Option aufgebraucht, dürfen nahe Angehörige im direkten Anschluss an die Pflegefreistellung zudem gewöhnlichen Urlaub konsumieren. Verfügt der Arbeitnehmer über genügend Resturlaub, muss dieser Urlaub vorab nicht explizit vom Arbeitgeber genehmigt werden. Der Arbeitnehmer ist dennoch dazu verpflichtet, den Arbeitgeber schnellstmöglich über den Pflegeurlaub in Kenntnis zu setzen. Anderes als beim gesetzlichen Jahresurlaub können nicht verbrauchte Pflegefreistellungszeiten zudem nicht in das darauffolgende Jahr mitgenommen werden.
Sonderfall: Krankenhausaufenthalt
Kinder, die das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, stehen unter ganz speziellem Schutz. Für diese Minderjährigen kann eine Pflegefreistellung auch dann konsumiert werden, wenn eine Erkrankung vorliegt, die eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus notwendig macht. In diesem Fall dürfen leibliche Eltern, unabhängig vom Wohnsitz, eine Pflegefreistellung geltend machen. Für Partner und Lebensgefährten gilt diese Regelung nur dann, wenn sie mit dem pflegebedürftigen Kind in einem gemeinsamen Haushalt leben.
Sonderfall: Betreuungsfreistellung
Arbeitnehmer können unter Umständen eine Freistellung auch dann in Anspruch nehmen, wenn das Kind gesund ist. Dies ist immer dann möglich, wenn die Person, die sich für gewöhnlich um das Kind kümmert, ihren Betreuungspflichten unerwartet nicht mehr nachkommen kann. Als unvorhersehbare Verhinderung zählt hierbei beispielsweise eine schwere Erkrankung, ein notwendiger Krankenhausaufenthalt oder der Tod der Betreuungsperson.
Welche Formvorschriften gibt es?
Prinzipiell bestehen keine besonderen Formvorschriften. Der Arbeitgeber hat jedoch das Recht, eine ärztliche Bestätigung zu verlangen, die nach Aufforderung auch vorgelegt werden muss. Die Pflegefreistellung kann bei einem gültigen Nachweis der Pflegebedürftigkeit aber nicht verwehrt werden.
Arbeitsverträge und betriebsinterne Verordnungen, die das Recht auf Freistellung aufheben, sind daher nicht gültig. Der Arbeitnehmer hat allerdings die Pflicht, Vorkehrungen zu treffen, um eine Dienstverhinderung aufgrund eines Pflegefalls zu vermeiden. Eine Pflegefreistellung ist beispielsweise nicht notwendig, wenn eine andere geeignete Person zur Verfügung steht, der die Pflege zumutbar ist. Dabei geht das Gesetz davon aus, dass die Pflege in erster Linie von Angehörigen durchgeführt wird.
Dem Arbeitnehmer wird in der Regel nicht zugemutet, dass er Drittpersonen, wie beispielsweise Pflegepersonal, einsetzt. Sind beide Eltern berufstätig, darf der Arbeitgeber außerdem nicht bestimmen, welcher Elternteil die Pflegefreistellung konsumiert.
Pflegekarenz und Pflegeteilzeit
Bei längeren Erkrankungen haben Arbeitnehmer die Möglichkeit, den Pflegebedarf durch Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit zu decken. Diese Optionen sind zeitlich auf ein bis drei Monate beschränkt und dürfen für ein und denselben Angehörigen maximal einmal je pflegender Person in Anspruch genommen werden. Die Pflegekarenz und die Pflegeteilzeit sind allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
Für Kinder und demenziell erkrankte Personen muss hierbei zumindest Pflegegeld der Stufe 1 bezogen werden. Für alle weiteren pflegebedürftigen Angehörigen darf die Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit erst ab Pflegestufe 3 in Anspruch genommen werden.
Welche Rahmenbedingungen gilt es bei der Pflegekarenz und Pflegeteilzeit zu beachten?
Um Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit zu konsumieren, muss der Arbeitnehmer über ein Arbeitsverhältnis verfügen, welches ununterbrochen, seit zumindest drei Monaten aufrecht ist. Angestellte, die nur einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen, haben keinen Rechtsanspruch auf diese Möglichkeit der Pflegebetreuung. Zudem muss eine schriftliche Vereinbarung mit dem Arbeitgeber getroffene werden, in welcher die Dauer der Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit festgeschrieben wird.
Eine Unterbrechung der Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit ist nicht möglich. In Sonderfällen, wie beispielsweise der Familienhospizkarenz, kann die Dauer jedoch auf bis zu neun Monate ausgeweitet werden. Für die Dauer der Karenz genießt der Arbeitnehmer einen Motivkündigungsschutz und ist zusätzlich weiterhin pensions- und krankenversichert. Arbeitnehmer, die Pflegeteilzeit konsumieren, dürfen eine wöchentliche Arbeitszeit von 10 Stunden nicht unterschreiten. Zudem erhalten anspruchsberechtigte Personen während der Pflegekarenz lediglich ein Entgelt in der Höhe des Arbeitslosengeldes, sofern die Geringfügigkeitsgrenze nicht unterschritten wird.